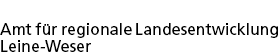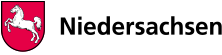PM 17/2025 Leine-Weser diskutiert Impulse für Landesförderstrategie
Zukunft gestalten: Leine-Weser diskutiert wichtige Impulse für die künftige Landesförderstrategie
Regionale Akteurinnen und Akteure kamen auf Einladung des ArL Leine-Weser zusammen, um die Weichen für einen sozialökologischen Wandel zu stellen
HILDESHEIM. – Wie kann die Region Leine-Weser den Wandel in Niedersachsen aktiv mitgestalten? Welche innovativen Ideen, Stärken und Potenziale schlummern hier bereits – und wo stoßen wir an Grenzen? Mit der sozialökologischen Transformation, die im Fokus der niedersächsischen Landesförderstrategie steht, stehen das Land und damit auch die Region Leine-Weser vor wegweisenden Veränderungen: Was braucht unsere Region, um diese Herausforderungen zu meistern? Und wie muss die Landesförderung zukünftig gestaltet sein, um gezielt unterstützen zu können?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden und die Perspektiven der Region Leine-Weser einzubringen, hat das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser (ArL Leine-Weser) am Donnerstag, 21. August 2025, zu einer zentralen Dialogveranstaltung eingeladen. Unter dem Motto „Gemeinsam Transformation gestalten – Impulse für die Landesförderstrategie Niedersachsen“ kamen regionale Akteurinnen und Akteure aus Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und neue Impulse zu setzen.
„Die Zukunft der Region Leine-Weser gestalten wir nur gemeinsam – mit den Menschen, die hier leben und ihre Perspektiven einbringen. Die sozialökologische Transformation ist unsere Chance, Stärken zu festigen, Herausforderungen anzugehen und nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Insbesondere in unserem ländlich geprägten Raum müssen wir dafür sorgen, dass niemand an der Peripherie zurückbleibt – das ist für die Erhaltung von Lebensqualität und unserer Demokratie von zentraler Bedeutung,“ sagte Ottmar von Holtz, Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Leine-Weser zu Beginn der Veranstaltung und betonte zugleich, die Ergebnisse der Veranstaltung bleiben nicht im Amt, sondern fließen unmittelbar in die Landesförderstrategie ein.
Im Anschluss gab Melanie Walter, Ministerin für Europa und Regionale Landesentwicklung, in ihrer Keynote wichtige Impulse für die strategische Ausrichtung der Landesförderung: „Die Ideen und Erfahrungen aus den Regionen sind auch für die künftige Landespolitik unverzichtbar. Es ist immens wichtig, dass wir uns in Niedersachsen auf Ziele und Schwerpunkte verständigen, die wir mit der EU-Förderung erreichen wollen. Europäische Mittel sind unerlässlich, um unsere Regionen sozial, ökologisch und wirtschaftlich resilient aufzustellen und für die Transformation fit zu machen. Ich möchte die Akteurinnen und Akteure der Regionen daher dazu ermutigen, sich aktiv einzumischen und die Vorbereitung der EU-Förderperiode 2028-2034 mitzugestalten. Denn es gibt zahlreiche Chancen für unsere Regionen, die wir nutzen können und sollten.“
Jörg Lahner, Wirtschaftsprofessor an der HAWK Göttingen, der die Veranstaltung wissenschaftlich begleitet und deren Ergebnisse für die Landesregierung aufbereitet, gab mit seinem anschaulichen Impulsvortrag zum sozialökologischen Wandel und der Rolle der Region Leine-Weser darin, den inhaltlichen Einstieg in den nachfolgenden Austausch. Der Forscher betonte, dass bei einem derart radikalen Wandel neben den Nachhaltigkeitsaspekten auch immer der Mensch mitgenommen werden müsse.
An Thementischen wurde anschließend zu „Nachhaltige Wirtschaft und Innovation“, „Energiewende und Mobilität“, „Daseinsvorsorge und Zusammenhalt“ sowie „Ländliche Entwicklung und Flächenmanagement“ diskutiert. Als Stärken und Potenziale, wurden beispielsweise das bürgerschaftliche Engagement, die bereits vorhandenen Netzwerke zwischen Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft oder auch Vorzeigeprojekte mit Strahlkraft wie das Zentrum für Mikromobilität in Diepholz hervorgehoben. Zugleich sahen die Teilnehmenden aber auch Herausforderungen auf dem Weg zum Wandel: Beispielsweise bestünde im ländlichen Raum noch Potenzial, die Erreichbarkeit, Attraktivität und Bezahlbarkeit des ÖPNV zu steigern, Prozesse zu optimieren, beispielsweise beim Flächenmanagement, um eine zügige und bedarfsgerechte Entwicklung zu unterstützen oder die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den Digitalisierungsprozess.
Insgesamt zeigte sich jedoch, dass die Teilnehmenden sich in ihrem Austausch untereinander mehr auf die konkreten Anforderungen und Erwartungen an die zukünftige Förderlandschaft konzentrierten: Ein übergeordnetes Fazit war daher, dass der Wandel nur gelingen könne, wenn der Weg gemeinsam gegangen werde. Weg vom Kirchturmdenken, hinzu mehr Kooperationen. Prozesse sollten vermehrt gemeinsam gestaltet werden, mithilfe von Moderation und Unterstützung durch Experten. Anreize, sich einzubringen und Synergien zu schaffen, müssten ausgebaut werden, etwa durch mehr Förderung, wenn sich zwei oder mehr Parteien zusammenschließen, so eine von vielen Ideen, die an den Thementischen entstanden sind.
Artikel-Informationen